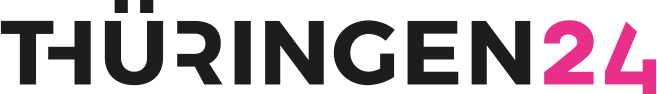Schon seit ihrer Gründung 2013 überlegt Deutschland, wie es mit der AfD umgehen soll. Dass eine derart offen rechte Partei mit so hohen Zustimmungswerten im Bundestag sitzt, damit ist man bis heute überfordert. Die CDU will die AfD irrelevant regieren, das BSW sie nicht weiter ignorieren und die SPD möchte ein Verbotsverfahren prüfen.
Aber wäre das, vorausgesetzt, der Verfassungsschutz stuft die AfD endgültig als rechtsextrem ein, wirklich der richtige Weg, diese Partei zu verbieten? Hier sind drei Gründe, die dagegen sprechen.
Auch interssant: ++Rassismus in der Schule – wie rechte Parolen im Klassenzimmer landen++
In der aktuellen Debatte über ein mögliches Verbot der AfD wird oft übersehen, dass ein solcher Schritt nicht nur rechtlich schwierig ist – schließlich muss dem ganzen Bundesverband eine rechtsextremistische Haltung nachgewiesen werden, die die Demokratie gefährdet. Auch politisch könnte ein Verbot der Partei Folgen haben.
1. Verbot verfehlt – Partei radikalisiert
Es könnte gar die gewünschte Wirkung verfehlen und stattdessen die Partei stärken oder weiter radikalisieren. Ein Verbot der AfD könnte sich schnell als kontraproduktiv erweisen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Partei ein Verbotsverfahren unbeschadet übersteht – beispielsweise, weil es an Beweisen mangelt oder es Fehler im Verfahren gab. Sollte dies geschehen, wäre die abschreckende Wirkung eines solchen Gerichtsprozesses für die Politiker dahin.
Schon gelesen? ++Rassismus-Eklat bei der Frauen-EM! Linke zeigt AfD-Mann an++
Im Gegenteil: Die Parteiführung könnte sich ermutigt fühlen, jene gemäßigten Kräfte und strategischen Zurückhaltungen, die aus Furcht vor einem Verbot bislang noch wirkten, aufzugeben. Dadurch würde die Gefahr bestehen, dass die AfD sich noch weiter radikalisiert und ihre extremistischen Tendenzen offen und ungehemmt auslebt.
2. Verbot erzielt – Wählerschaft noch da
Ein weiteres Szenario nach einem erfolgreichen Verbot der AfD ist, dass die Partei dann zwar zerschlagen wäre, die dahinterliegenden gesellschaftlichen und politischen Einstellungen aber nicht. Die anhaltende Zustimmung zur AfD und die hohen Wählerzahlen machen deutlich, dass es in Teilen der Gesellschaft eine Nachfrage nach einer klar rechten, populistisch auftretenden Kraft gibt.
Selbst wenn die AfD also verboten würde, blieben die dahinterstehenden Überzeugungen bestehen. Die Menschen würden sie eventuell anders äußern, als nur mit dem Gang zur Wahlurne. Diese Entwicklungen könnten sich dann in anderen Strukturen oder neuen Parteien organisieren – möglicherweise noch radikaler und schwerer kontrollierbar als zuvor.
3. Wohin dann mit den AfD-Wähler:innen?
Aus demokratietheoretischer Perspektive wirft ein Verbot der AfD erhebliche Fragen auf. Es geht nicht nur um die Partei selbst, sondern um den Umgang mit ihren Wähler:innen, die einen bedeutenden Teil der Gesellschaft repräsentieren. Die Frage ist nun, wie mit dem nicht so kleinen Teil der Bevölkerung umgegangen werden soll, der seine politische Heimat verliert – das ist immerhin etwa ein Fünftel der Wähler.
Mehr News:
Die Hoffnung, dass diese Menschen sich einfach in das bestehende Parteienspektrum eingliedern lassen, erscheint wenig realistisch. Im schlimmsten Fall könnte ein solches Verbot die politische Isolation und Frustration dieser Gruppen verstärken.